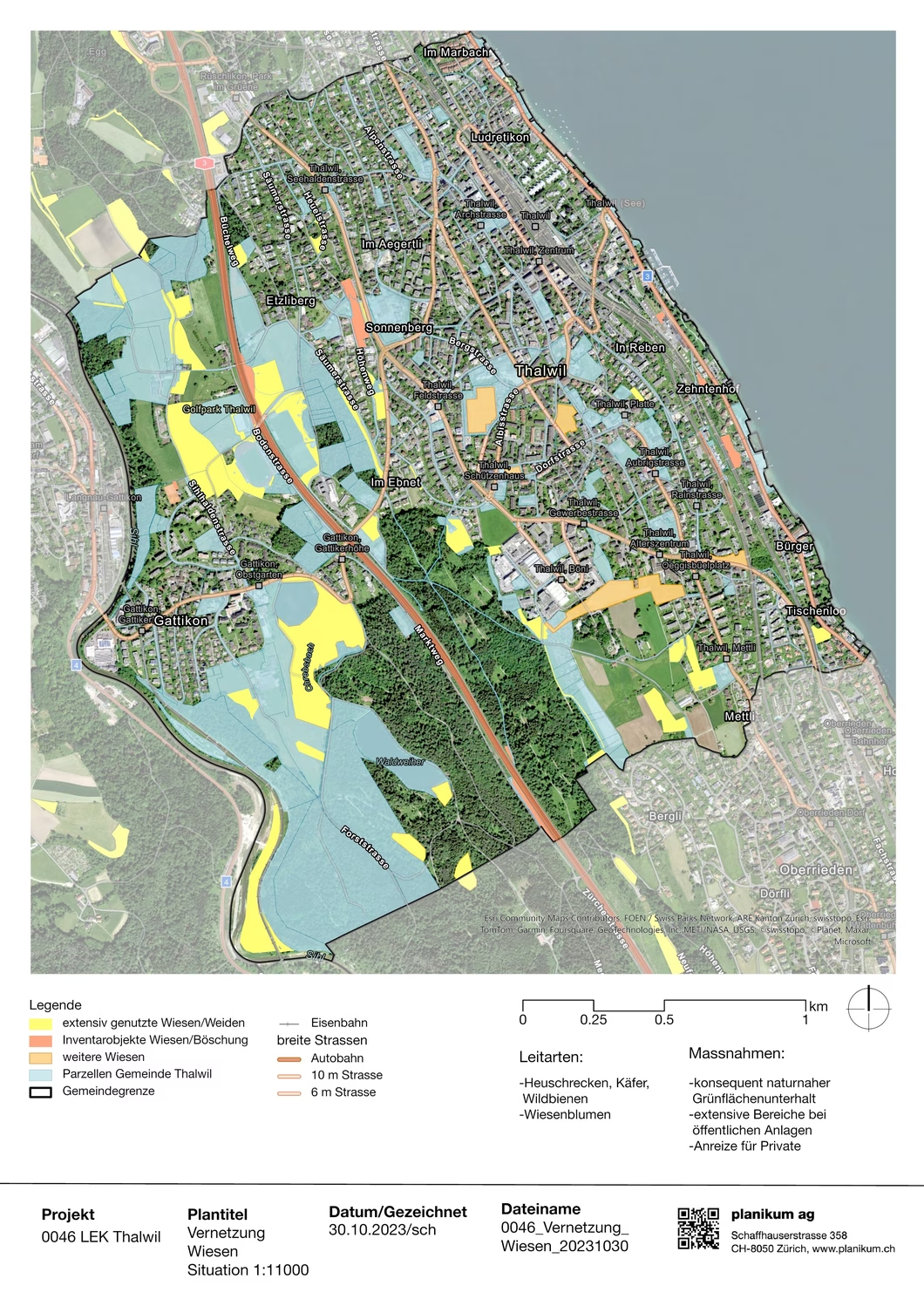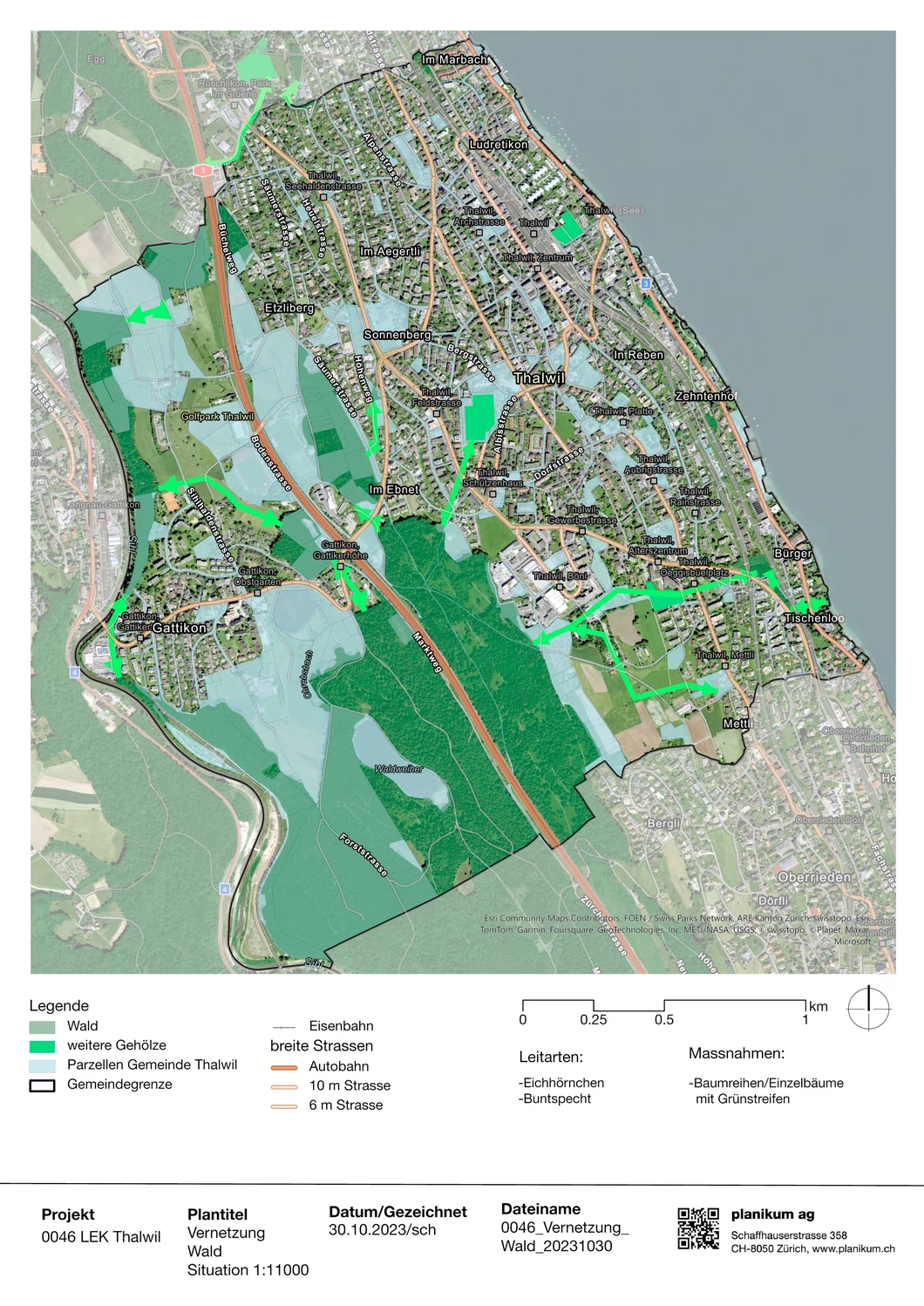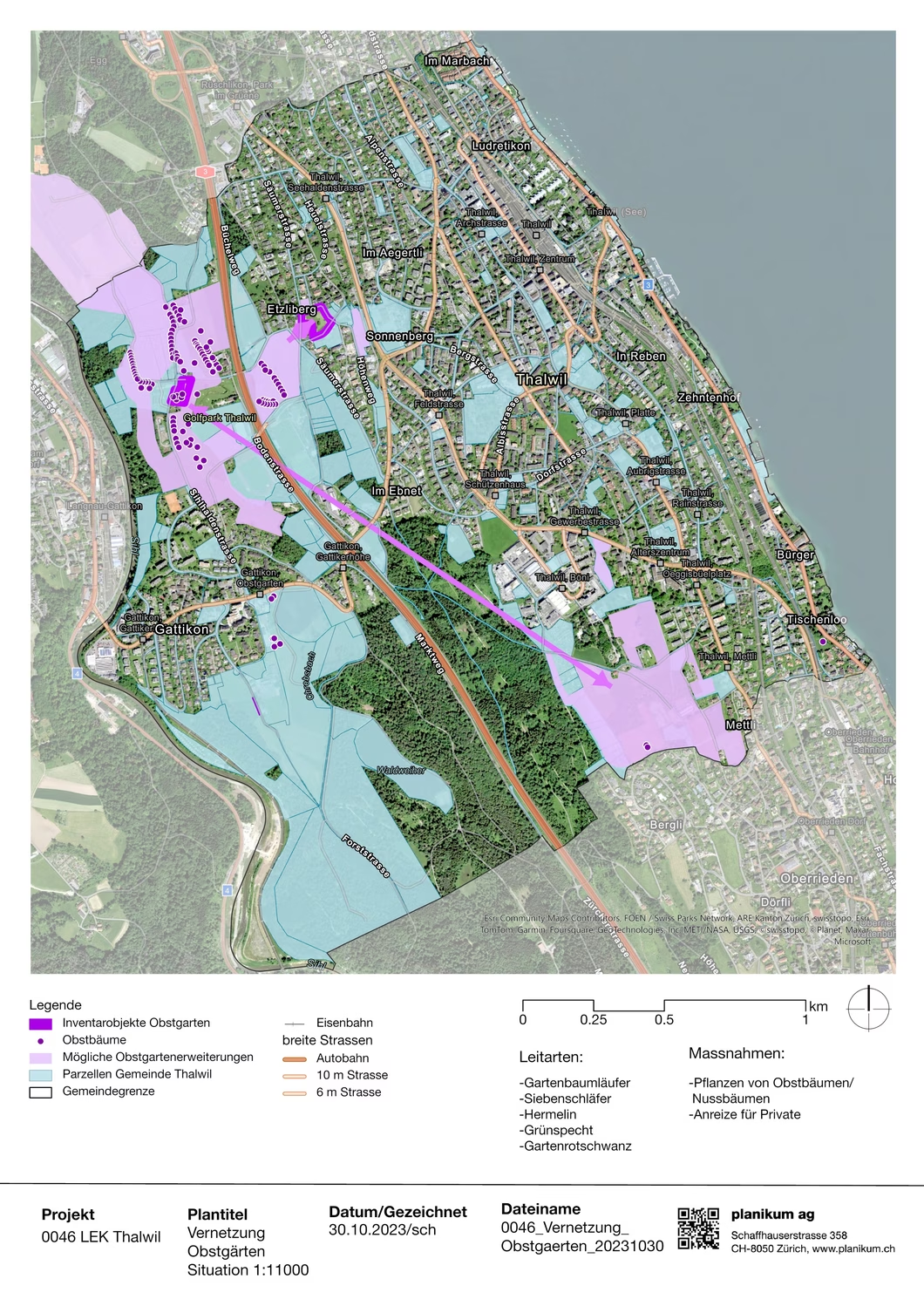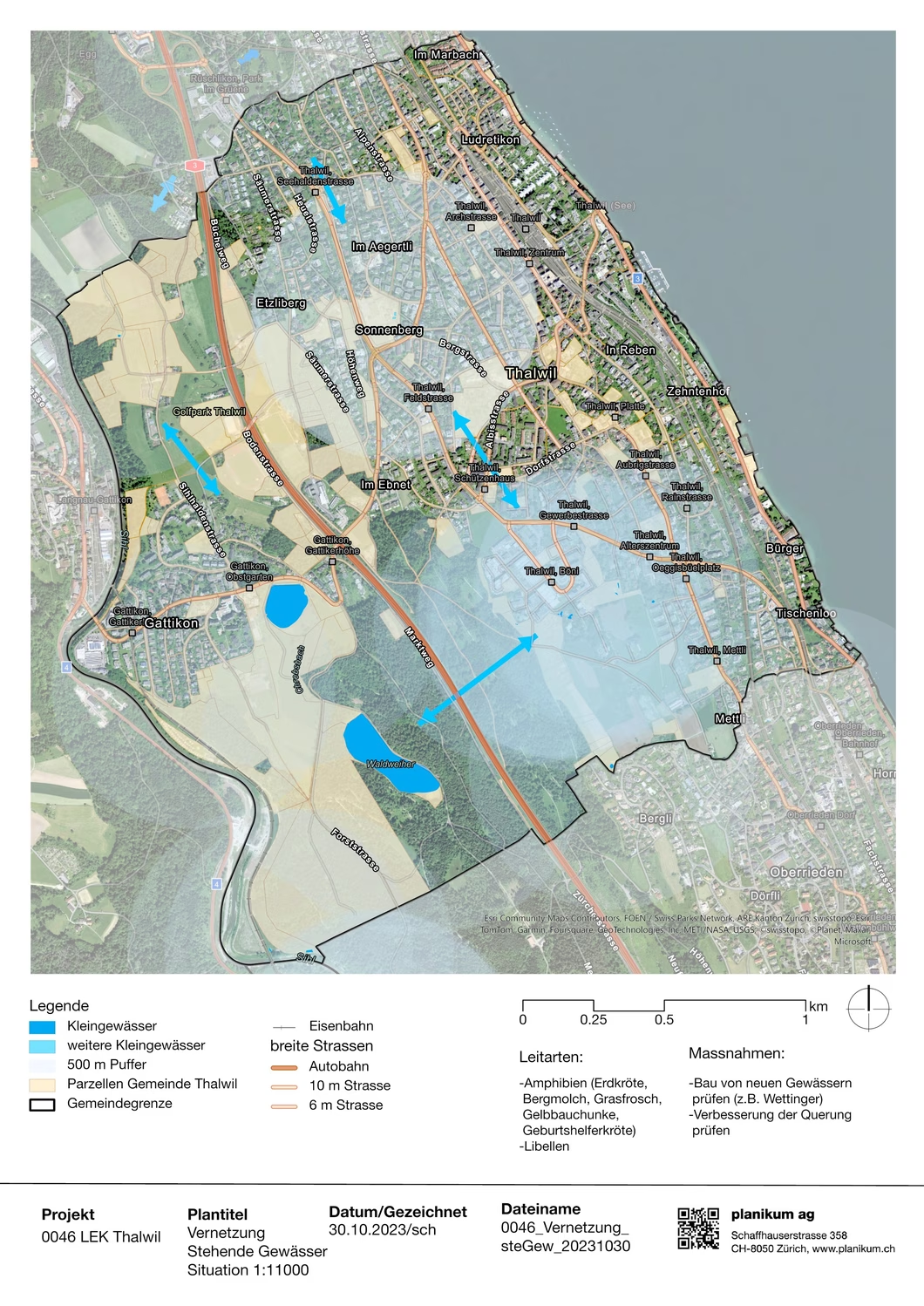1. Jahr Förderprogramm
Zur Erreichung der Klima- und Energiewendeziele muss der Energieverbrauch reduziert werden, die Wärmeversorgung auf dem Gemeindegebiet umgestellt und mehr erneuerbarer Strom auf Thalwiler Dächern produziert werden. Die Gemeinde Thalwil unterstützt die Bevölkerung bei diesen Herausforderungen finanziell und mit Beratungsleistungen. Für das kommunale «Förderprogramm Klima» hat die Gemeindeversammlung am 7. Dezember 2023 einen Rahmenkredit von einer Million Franken gesprochen. Seit Januar 2024 können Thalwilerinnen und Thalwiler Fördergesuche einreichen. Die Gesuchseinreichung läuft über ein Online-Portal. Finanziell gefördert werden der Heizungsersatz, der Bau von Photovoltaikanlagen, Betriebsoptimierungen und Beratungsleistungen. Des weiteren hat die Gemeinde das Angebot einer kostenlosen Energiesprechstunde für die Bevölkerung geschaffen. In dieser beraten von der Gemeinde akkreditierten Energiefachpersonen zu Themen wie Wärmedämmung und Heizungsersatz, aber auch zum Energiesparen im Haushalt. 2024 haben neun Energiesprechstunden stattgefunden.
Die Grafik zeigt die Anzahl der eingereichten Gesuche je Fördergegenstand und die Menge der reservierten und bereits ausgezahlten Gelder im Zeitraum Januar bis Dezember 2024. Ende 2024 waren bereits rund 36'000 Franken an 13 umgesetzte Projekte ausgezahlt. Weitere 232'000 Franken waren für 55 Projekte reserviert. Die meisten Fördergesuche werden für Photovoltaikanlagen und Heizungsersatz eingereicht.